Villa Adriana - mehr als ein kaiserlicher Prunkpalast
- Hilda Steinkamp

- 12. Sept. 2025
- 5 Min. Lesezeit
Rückzug und Regentschaft vor den Toren Roms in Tivoli

Eine Villa im antiken Rom
außerhalb der Stadtmauern ist kein Landhaus, sondern ein Landgut.

Kaiser Hadrians Besitz ist so eine ländlich gelegene Residenz. Eine Palaststadt 6 km vor Tivoli (Tibur) gelegen, heute Teil der Metropolitanstadt Rom. Offensichtlich mit dem Instinkt eines Projektentwicklers ausgesucht. "Die Lage ist alles" - galt damals noch uneingeschränkt, heutige Immobilienmakler hätten nicht besser beraten können:

klimagünstige Position auf 150 m Höhe
Panoramablick auf die Hügel von Tivoli
verkehrsgünstige Verbindung nach Rom über die Via Tiburtina
baugewerblich erschlossener Grund mit Palast aus republikanischer Zeit
tiburtanische Steinbrüche für Baumaterialien
Tuffstein als weicher Baugrund für unterirdische Versorgungswege
Wasserversorgung durch die nahegelegene Aqua Marcia, den damals weltweit größten Aquädukt
Ein kolossales Bauvorhaben, das Hadrian da in Auftrag gab, ein Jahr nach seinem Amtseintritt 117 n. Chr. Er betreute es selbst als Bauleiter und nutzte diesen Hauptwohnsitz bis zu seinem Tod 138. Der größte Palastbau, den je ein Kaiser errichten ließ. Und der besterhaltene aus römischer Zeit. Auf ca. 120 ha breitet sich die Villa Adriana aus. Das sind 12 km². Platz für 300 Fußballfelder. 20-40.000 Beschäftigte waren in der Bauphase von 118-134 tätig. Bis zu 20.000 Menschen lebten dort nach Fertigstellung, davon geschätzte 5.000 Sklaven.

Etwa 40 ha der Hadriansvilla mit 30 Gebäuderesten kann man heute noch besichtigen. Ich nehme mir dazu fünf Stunden an Muße, stecke 3 Liter an Wasser ein und mute meinen Füßen an die 15.000 Schritte zu, mit stopovers, stilgerecht, wie hier vor korinthischer Säule. Und keine Frage: Die 30 Ruinen habe ich nicht alle geschafft.
Einen Schwund an Bausubstanz hat entweder der Zahn der Zeit besorgt. Oder fragile Gebäude sind fürs Publikum geschlossen. Oder Bauzäune sperren Areale für die Öffentlichkeit ab, wenn darunter noch antike Bausubstanz vermutet und aktuell gegraben wird. Immer noch gehen nach Wiederentdeckung der Villa im 15. Jahrhundert die Ausgrabungen weiter. Selbst 2024 sind Archäologen dabei, versunkene Schätze ans Licht zu bringen. So berichtet Storica National Geographic von einem herrschaftlichen Bankettsaal in der Mitte eines Wasserbeckens (www.storicang.it).
Sommerresidenz für kaiserliches Vergnügen?
Keineswegs. Kein Lustschloss, wie es für einen kurzen Erholungsaufenthalt adeliger Bewohner jenseits von Hofzerimoniell und Amtsgeschäften gebaut wurde.
Hadrian plante sein privates Domizil anders. Als Ort für Rückzug und Regierungsgeschäfte. Für otium und negotium - Freizeit und Arbeit. Rom mit dem Kaiserpalast auf dem Palatin blieb weiterhin der politische und administrative Mittelpunkt des Reichs.
Regierungs- und Vergnügungsviertel - so habe ich bei meinem Villenbesuch die Vielzahl an Gebäuden, Thermen, Tempeln, Theatern, Stadien, Nymphäen und Zierbrunnen sortiert. Sonst verliere ich mich.
Das Regierungsviertel
Der Palastkomplex wurde als erstes fertiggestellt, mit geräumigen Arbeits-, Besprechungs- und Audienzräumen. Einige Gebäude wurde von Archäologen nach dem vermuteten Nutzen bezeichnet, auch phantasievoll, dann mit dem Zusatz "detto": "sogenannt".
Die sog. Bibliotheken waren Arbeitsräume: Biblioteca greca e latina
Der sog. Sala dei filosofi diente dem Empfang:

Kein offizieller Palastraum war das Teatro Marittimo. Nur die runde Architektur gleicht einem Theater. Tatsächlich war dies der private Rückzugsort des kaiserlichen Managers. Ein Inselpavillion, von Wasser umflutet und von einem Rundbau umgeben, eine Miniaturvilla mit allem Wohnkomfort, Bäder und Therme inklusive:
Gästeunterkünfte gab es reichlich. An Ausstattung und Nähe zum kaiserlichen Palast lässt sich die Ranghöhe der Besucher ablesen.

Marmor in Grün-, Gelb- und Rottönen aus den entfernten Provinzen des Reichs wie der Türkei und Ägypten fand Verwendung in Räumen für höherstehende Regierungsmitglieder.

Fußbodenmosaik in Schwarz-weiß aus italienischen Marmorbrüchen gehörte zur schlichten Ausstattung in Unterkünften für rangniedrigere Besucher.


Eine ausgedehnte Wohnanlage weit außerhalb der Sicht des Kaisers und seiner noblen Gäste wurde in den frühen 2000er-Jahren aus dem Erdreich freigelegt. In kleinsten Parzellen mit Versorgungsräumen auf Hoch- und Tiefetagen lebten bis zu 1.500 einfache Bedienstete. Cento Camerelle, 100 Kämmerchen, so klingt die fast liebevolle Verniedlichung der Entdecker für dieses antike Massensilo:

Speisesäle waren ebenfalls gesellschaftlich markiert: schlichte quadratische Säulen (pilastri) in Sälen für untere Regierungsbeamte (praetori); kunstvolle runde Säulen mit Kapitellen (colonne) in der gehobene Ausstattung für die Hierarchiehöheren.

Die als Triclini Imperiali benannte Gastronomie ist nicht kaiserlich. Die Nähe zu den Hospitalia spricht für ein einfaches Restaurant. Was die Besucher heute als kunstvoll er- und begreifen, ist zwar echt, aber nicht authentisch. Denn die Säulen mit stilvollen korinthischen Kapitellen brachten Archäologen offensichtlich aus dekorativen Gründen ins Spiel und in den Gastraum:
Standesgemäß speiste der Kaiser mit seinen hochrangigen Gästen an anderer Stelle, im Quadriportico con Peschiera, einem mehrgeschossiges Wohn- und Repräsentationsgebäude mit einem Pool für Zierfische (peschiera).

Der Ausblick auf das Wasserbassin im Hof mit Säulengängen und weiter auf die Hügel von Tivoli spricht deutlich für hochherrschaftliche sommerliche Empfänge und Banketts.
Für den ganzjährigen Betrieb sorgte eine Klimaanlage, die durch Leitungen in Mauern und Fußböden hydraulisch Wasser schickte, das im Sommer aus kühlem Aquädukt floss und im Winter über Brennöfen im Untergeschoss erhitzt wurde. Der archäologische Beiname Palazzo d'inverno, Winterpalast, zollt Tribut den begabten Heizungsingenieuren und ihrer Airconditioning-Anlage vor knapp 2000 Jahren, damals unter dem Namen hypocaust system bekannt.

Standesunterschiede bestimmten auch die Wandgestaltung. Marmorplatten, Fresken, Reliefs, Friese und Nischen für Marmorstatuen finden sich in Kaiserquartieren. Schlichte Wandgemälde zierten Gästebehausungen.
Die soziale Hierarchie machte auch nicht vor den Latrinen halt. Einzellatrinen im Marmor-Design für den Kaiser und Seinesgleichen. Sammellatrinen mit Zweckeinrichtung für Bedienstete und Saunisten. Alles Hocktoiletten, WC alla turca, aber komfortabel mit Wasserspülung.
Unweit des Winterpalasts liegt eine noch imposantere Anlage für kaiserliche Empfänge und höchstrichterliche Geschäfte, die Sala dei Pilastri Dorici. Der offene großräumige Platz war wohl einst überdacht.
Die Sala trennt das Regierungsviertel an ihrer Rückseite von der Piazza d'Oro. Und so schreite ich direkt hinein ins ...
... Vergnügungsviertel
Auf der Piazza d'Oro imponiert mir ein riesiges Wasserbecken mit umlaufender Gartenanlage, ein Wasserspiel (ninfeo) an der einen Schmalseite und ein Gebäudeteil mit Gasträumen und Aborten zur Einzelnutzung an der anderen. Ein trefflicher Ort zum Dinieren im Freien oder unter Dächern und zum Lustwandeln in Muße. Vom kaiserlichen Design mit vielfarbigen Marmorböden, Säulen und Skulpturen wurde vieles geplündert als Baumaterial oder Sammlerobjekt.

Lässt sich dieses Freizeit- und Erholungsareal noch toppen? Denn immerhin: Die Villa Adriana bei Tivoli inspirierte die Erbauer des Vergnügungsparks Tivoli in Kopenhagen bei der Namensfindung.
Ja, meine Sinne und Schritte steuern Höhepunkten entgegen. Mit mehr Willen als Kraft. Und süchtig nach Schattenbezirken. Die finde ich reichlich unter den jahrhundertealten Olivenbäumen:

Dann mit neuem Elan entlang der Bäderanlagen. In den Piccole Terme suchte der Kaiser Entspannung. Die Grandi Terme waren fürs Villenvolk:


Getrennte Bäder, Latrinen und Gymnastiksäle für Männer und Frauen sowie schlichte schwarz-weiße Mikro-Mosaiken als Fußbodenbelag deuten auf eine vielfrequentierte Wellness-Oase für Gäste und Bewohner.
Fußboden- und Wandbeheizung gehörte zur wärmetechnischen Standardausstattung in der Villa.
Luxus für jedermann!
Das Schlusslicht auf meinem Antik-Parcour ist das wahre Glanzstück der Villa Adriana:
Canopo e Serapeo, ein exotisch anmutendes Bauwerk mit Wasserbecken und Pavillon:
In dieser ansehnlich restaurierten Anlage fließen die Reiseimpressionen eines Kaisers zusammen, der als kunstverständiger Globetrotter Stilrichtungen aus seinen Provinzen Ägypten, Griechenland und Persien mit römischen Bauelementen kombinieren ließ.
Ägyptisch:
der Kanal, der die Stadt Canopus mit Alexandria verbindet
der Pavillon als Nachbildung des Serapis-Tempels
das Krokodil am Beckenrand
der Nil als Vaterfigur
Griechisch:
Karyatiden von der Akroplis
Kriegsgott Aries und Krieger Theseus
Säulen mit korinthischen Kapitellen

Römisch bzw. persisch:
der Tiber in Vatergestalt
Rundbögen und Kuppeln
Hadrians "Goldenes Zeitalter"
Die Villa Adriana - eine kaiserliche Machtinszenierung? Fast möchte man es glauben, wenn man das Areal erlebt hat.
Doch fürs römische Reich war seine Herrschaft eine Zeit der Stabilisierung: Hadrian gab jüngste Eroberungen unter Trajan im Osten und an der Donau den rebellierenden Völkern zurück, sicherte die Schlagkraft des Heeres, machte die Rechtsprechung zum dauerhaften Regelwerk, förderte Diversität, Bildung, Wohlstand und Infrastruktur, pflegte kulturelle Traditionen und tolerierte ethnische Bräuche, hielt historische Bauten instand, baute außer der Villa die Engelsburg (sein Mausoleum) und das Pantheon.

Und starb mit 62 Jahren eines natürlichen Todes, ohne Mord und Totschlag im Kampf um die Nachfolge. Einer der wenigen im Römischen Kaiserreich. Spricht alles für Adriano als völkerverständige Herrscherfigur.
Dass der 14. römische Kaiser mit seiner griechischen Haartracht - Haar und Vollbart kurz und gelockt - junge Zeitgenossen für die hellenistische Kultur begeistern konnte, klingt fast nach popkulturellem Talent.








































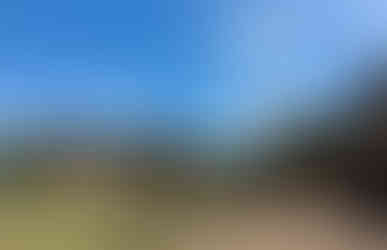














































Kommentare