Turbinen und Turbulenzen in Tivoli
- Hilda Steinkamp

- 27. Mai 2025
- 9 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 29. Aug. 2025
Pionierfahrt von Rom zur Villa d'Este

Auf Entdeckungsreise
Ich muss mal raus aus der Stadt. Aus meinem Airbnb-Home in Rom, wo ich mich für den gesamten Dezember eingemietet habe. Padrona Antonella bietet fürsorglich ihre Hilfe an: „Non farti problemi a chiarmarmi“, ich soll nicht zögern, sie zu fragen, wenn ich etwas brauche. Ja, brauchen könnte ich was: Tipps für lohnende Fahrziele außerhalb Roms.
Die kommen prompt: Tivoli mit Villa d’Este aus der Renaissancezeit, dann noch zwei weitere Villen, älter, eher ruinöse Überreste aus den Glanzzeiten des römischen Reichs: Villa Adriana, Villa Gregoriana.


Keine 40 km von hier. In 60 Minuten wartet auf mich und meinen wendigen Fiat 500 in der sportlichen Abarth-Ausführung - eine huldvolle Gabe des Autoverleihers im mietarmen Dezember - das komplette Kontrastprogramm zur belebten Hauptstadt mit ihren altertümlichen Publikumsmagneten und pulsierenden Verkehrsadern.
Sonntagmorgen. Sonne pur. Es sollen 20 Grad Winterwärme werden. La 500 kommt ins Rollen. 6 Liter auf 100 km - so werde ich später staunen - machen mich konkurrenzlos günstig mobil. Kein Vergleich zu meinem durstigen Gefährt zu Hause in Berlin. Rein ökonomisch gesehen.
Das Navi auf dem Bordschirm ist nicht installiert, mein Tastendruck produziert nur das Firmenlogo. Mal wieder das Kleingedruckte im Mietvertrag lesend übersprungen. Also müssen Google Maps im Handy herhalten. Sind ja auch satellitengesteuert tagesaktuell. Doch ohne Halterung per Saugnapf auf dem Display des Fiat-Armaturenbretts – so wie in meinem heimischen Bentley, Halb-Oldie – scheint mir das Handy eine wackelige Orientierungshilfe auf meinem Schoß zu werden. Ich verbinde das Gerät über das Ladekabel mit der Powerbank tief in meinem Rucksack auf dem Nebensitz, so kann es nicht auf den Boden rutschen, spontane Vollbremsungen sind auf Roms Straßen an der Tages-, ähm, Verkehrsordnung. Und Power Cuts sind so beim akkuintensiven Navigieren auch ausgeschlossen.
Eine fehlerunanfällige Ausflugsplanung! Eine letzte Hürde in Tivoli wird genommen. Nach dreimaligem nervigen Rotieren im Kreis – elektronisches Kartenmaterial ist bedingt tauglich, erkennt hier keine Fußgängerzone – ergreife ich meine analoge Chance und frage zwei carabinieri in schmucker dunkelblauer Uniform und lässiger Sonntagsmuße in ihrem frischpolierten gepanzerten Jeep nach dem Weg zur Villa d’Este. Da helfen sie doch gern, mit knapper Feldansage in Feiertagslaune und umschmeichelnden Blicken für die fremde Lady, die sich um ihre Sprache bemüht. 200 Meter weiter ins Parkhaus, dann zu Fuß noch mal so weit durch die Fußgängerzone bis zur Villa.

Das klingt mehrfach verlockend. Ziel vor der Nase und 1 € Parkgebühr pro Stunde – das möchte ich mir leisten. Italienische Preisgarantie fürs innerstädtische Parken selbst in den kulturellen Hotspots seit den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts! Und Schonung fürs Reisebudget im Vergleich zu den jüngsten drastischen Erhöhungen in deutschen Mittel- und Großstädten auf 4 € für den gleichen Stunden-Service. Italiener lieben la macchina - das femminine Genus macht das Auto grammatisch weiblich und weckt die männlichen Sinne. Mehr noch mögen sie spendable Besucher, die im Auto ihre historischen Innenstädte ansteuern und dort verweilen und die lokale Wirtschaft beleben - mit Ausgaben für Kultur, Kommerz und Kulinarik .

Die Villa d’Este
versetzt mich wahrhaft augenblicklich in die Hochrenaissance des 16. Jahrhunderts.
Ein mehrstöckiges palastähnliches Gebäude in Hanglage auf einem Hügel zwischen Weinfeldern und Olivengärten am Rande des mittelalterlich geprägten Tivoli.
Der Salon auf dem piano nobile
öffnet sich auf eine großzügige Aussichtsplattform, umrahmt von marmornen Balustraden. Von hier aus weitet sich der Blick über den terrassenförmig angelegten Hanggarten mit seinen Brunnen, Wasserbecken, Wasserfällen, Grotten und Skulpturen bis hin zur hügeligen Landschaft der Region Lazio am Horizont.

Meine villetta romana in verwunschenem Kleingarten – eine charmante kleinbürgerliche Miniaturausgabe dieser trefflichen Renaissance-Kulisse!
Villa d'Este im Wandel der Zeit
Das ehemalige Benediktinerkloster Ippolitos II. d'Este - Enkel von Papst Alexander (Borgia) VI., wohlhabender Kardinal und Statthalter von Tivoli - wurde auf dessen Geheiß ab Mitte des 16. Jahrhunderts von angesagten Baumeistern und Künstlern der Renaissance zum herrschaftlichen Wohnsitz gestaltet und über ein Jahrhundert lang mit fortgesetzten Gestaltungsideen für Garten, Brunnen und Nymphäen prunkvoll weiterentwickelt – so entstand dieses Wunderwerk an Gartenbaukunst und Wohnarchitektur.
Nach der Familie Este mit ihren weltlichen wie kirchlichen Stammhaltern, die sich der Förderung der Künste verpflichtet fühlten, beförderten in den nachfolgenden Jahrhunderten wechselnde Herrscher- und Besitzverhältnisse das Anwesen in den Ruin. Kultureller Wechselkurs (nicht nur) all’italiana. Auf Renovierungsmaßnahmen folgten immer wieder Phasen der politisch bedingten Stagnation und Zerstörung, wie leere Kassen seit Übergang in den Besitz des italienischen Staates nach dem 1. Weltkrieg oder Bombenschäden im 2. Weltkrieg. Seitdem die Villa d’Este 2001 in den Stand des UNESCO Weltkulturerbes erhoben wurde, fließen wieder reichlich Gelder zur Instandhaltung, letztlich auch über die für italienische Verhältnisse strammen Eintrittspreise.
Mein Erlebnis in Villa und Garten d'Este
ist preislos. Fresken sind flächendeckend auf drei Etagen zu bestaunen, an Wänden und Decken mit Motiven aus Mythologie, Geschichte und Zeitgeschehen und in nahezu makellosem Zustand. Namhafte Häupter der antiken Geistesgeschichte säumen Simse an Wänden und Kaminen.
In Serpentinen angelegte Gartenwege mit breiten und befestigten Stufen mindern für Spaziergänger das Gefälle auf dem terrassenförmig angelegten Gartenhügel. Und erleichtern vor allem den steilen Aufstieg zurück ins hochgelegene Domizil. Lediglich der grüne Span auf den Steinen im Schattenbereich der Laubengänge muss kurz auf Trittfestigkeit geprüft werden. Aber an diesem sonnigen Dezembermittag keine Chance auf eine Rutschpartie. Alles läuft erfreulich anders glatt.
Ich mache Halt.
Oberhalb des Neptunbrunnens mit seinen gigantischen Fontänen und Wasserkaskaden prunkt ein Orgelbrunnen mit einer hochgebauten Fassade aus dem frühen 17. Jahrhundert.

Die Nischen der Fassade beherbergen stattliche Figuren aus der antiken Mythologie:
Apollo und Diana neben namenlosen Gestalten, entblößte Nymphen über Jünglingen mit Feigenblatt vor der Scham. Verhüllungsgebot für die – man staunt - phallische Form in der nicht mehr ganz so freien barocken Kunst nach der Renaissance.

Der Orgelbrunnen
verdient seinen Namen. Nicht das Wasser zaubert hier die Klänge, sondern ein schlichtes Musikinstrument, verborgen hinter einer Holztür in der unteren Fassadenmitte. 144 Orgelpfeifen sollen wasserbetrieben vier Renaissance-Stücke von vier Minuten Dauer ertönen lassen. Musikalische Turbinen - welche Seltenheit!
Wann denn? Das will ich hören. Das Internet schweigt darüber. Dort lese ich nur, dass die Pfeifen nach längerem Verstummen seit 2003 wieder zu hören sind, eine pneumatisch-hydraulische Ingenieursglanzleistung des späten 20. Jahrhunderts. Ich bin gespannt auf dieses schräge Musikevent.
Und frage mich durch. Komme zum Souvenirladen. Die Leute da könnten das doch wissen. Um 14.30 Uhr soll's losgehen, erfahre ich. Es ist jetzt 13 Uhr. Lohnt es sich zu bleiben, frage ich die Verkäuferin. „Beh, sono solo pochi minuti.“ Na ja, es dauert ja nur wenige Minuten, klingt es gelangweilt aus dem Mund einer an Kunst und Tourismus übermäßig gewöhnten Angestellten, die auf ihren sonntäglichen Feierabend hinlebt.

Aber Franz Liszt hat sich doch vom Wasserspiel aus dem Neptunbrunnen inspirieren lassen, als er hier zu Gast war und Klavierstücke komponierte, wende ich anerkennend ein.
„Ah, sì, sì“, beeilt sich meine Plauderpartnerin zu versichern. „Vuoi comprare i suoi Giochi d’acqua a Villa d‘Este?“, fragt sie mich mit wiedererwachtem Geschäftssinn. „Abbiamo il CD!“ Nein, kaufen möchte ich seine Wasserspiele nicht, schon gar nicht auf einer Retro-CD, wozu zahlen, wenn man kostenfrei streamen kann? Ich sage artig ab: „No, grazie. Vado ad ascoltare i Giochi al vivo. E arrivederci“.
Für den Live-Genuss der Wasserspiele suche ich ein Sonnenplätzchen auf einer Steinbank vor dem Orgelbrunnen auf. Meine Sinne spannen sich.
14:30 Uhr. Endlich. Eine kleine Anzahl an Besuchern hat sich vor dem Event-Brunnen versammelt. Die Holztür zu den Orgelpfeifen öffnet sich in quietschender Zeitlupe. Ein, zwei knatternde Orgeltöne. Abbruch. Noch einmal. Fehlversuch. Musik-Turbine streikt. Beim dritten Anlauf dann eine ungebrochene Tonfolge. Es erheben sich die Handys zur Videografie. Einzelne Töne perlen durch die Luft, verhalten, etwas blechern, wie aus der Drehorgel, noch ohne melodiösen Zusammenhang. Ob sich uns da gerade Liszts Notenkunst mitteilt? Von der Klaviatur zur Orgelei? Egal. Es zählt das erlebte Zusammenspiel von zaghaften Orgeltönen vor uns und gewaltigen Wassertönen hinter und unter uns aus den Fontänen und Kaskaden des Neptunbrunnens.
Ich drücke auf das Video-Aus. Zufrieden. Ereignis im Kasten.
Einbruch-Alarm
Da! Eine neue Melodie schließt sich nahtlos an. Aus meinem Mobilphon. Schriller noch als aus dem Orgelblech. Synthetisch. Aus der Ajax-App, Security-Mitteilung im Alarmton: „Fenster im Wohnzimmer geöffnet.“ Einbrecher in meinem Haus! Mein Notebook liegt dort offen auf dem Tisch. Zwar passwortgesichert. Die externe Festplatte daneben aber nicht. Auf beiden meine Webseite mit meinem Reise-Blog, weitere Schreibprojekte und sensible Interna. Das kriege ich nie wieder. Panik-Szenarios in meinem Kopf beginnen zu rasen.
Dazwischen ein klarer Gedanke: Antonella muss hin! Schreib' ich ihr. „Una notizia di Ajax – salone aperto. Io però sono a Tivoli … cosa c’è da fare?“ Wohnraum offen. Bin ja weit weg, in Tivoli. Was ist zu tun? „Vado io, ma non riesco prima di mezz‘ora.“ Sie will hinfahren, schafft es aber nicht unter einer halben Stunde.
Ich bin entlastet, aber weiter unruhig, breche meine Kunsttour ab, zahle den Billigtarif am Parkautomaten und presche mit bescheidenen 135 PS bei 90 km/h Tempolimit in Richtung Rom. Mit nur einem schrägen Seitenblick auf die säumenden Pinienreihen, so typisch für Rom und Latium.

Unterwegs dann Antonellas Telefonaufklärung. Ich halte auf der Standspur. Motor aus. Handy in Hand beim automobilen Navigieren – da kennt auch die polizia stradale in Italien kein Pardon. Die multe, Straftickets, sind hier fürstlich. Fehlalarm, trällert Antonella, der Wind habe wohl an der inneren Holzfenstertür gerappelt, Berührung mag die äußere Metalltür bei aktiviertem Alarmschutz nicht, sie löst die Katastrophenmeldung aus. Uffa! Ich atme auf.

Padrona will die klappernde Holztür im Hochparterre, die den Alarm ausgelöst hat, von innen verschließen und das Haus wieder verlassen, allerdings durch eine andere Eingangstür, die im Souterrain. Ich sage ihr noch, dass ich nur einen von den vielen Schlüsseln mitgenommen habe, nicht den fürs Souterrain, sondern nur fürs Hochparterre. Sie beruhigt: „È tutto a posto“, alles in bester Ordnung. Ich denke mir nichts weiter dabei.
Kurs auf die Piazza del Quirinale

Ich denke und lenke um. Zurück nach Tivoli und zu den verpassten altrömischen Villenruinen lohnt nicht mehr wegen der frühen Schlusszeiten im Winter. Also auf zu neuen Ufern – zum frühen Sonnenuntergang gegen 16:30 Uhr auf den höchsten der sieben Hügel Roms, darauf der Palazzo del Quirinale, Sitz des italienischen Staatoberhaupts, seit 2015 ist dies Sergio Mattarella, hochbetagter Presidente della Repubblica.
Auch dieser palazzo auf dieser piazza hat eine lange und wechselvolle Geschichte erlebt. Sagenumwoben seine Ursprünge, römische Siedlung mit Verehrung des Gottes Quirinus, der dem Hügel den Namen gab. Dort soll auch Romulus, der ebenso mythologisch überlieferte Stadtgründer, nach seinem Tod zunächst in die Götternachfolge erhoben und dann zu Grabe getragen worden sein. Noch heute liegen unter dem Präsidentengarten Überreste antiker Tempel. Angrenzend findet sich ein Nobelviertel im Renaissancestil, das auf den Ruinen der Villen der einstigen römischen Oberschicht ruht, die die gesunde Höhenluft auf dem Quirinale-Hügel den Sumpfgebieten am Tiber im Tal vorzogen. Das heutige Rom thront auf den Bauschichten seiner Vorgänger-Zivilisation.

Der heutige Quirinalspalast aus dem späten 16. Jahrhundert blieb lange im Besitz der gesellschaftlichen Oberschichten, gastierte drei Jahrhunderte lang als Sommerresidenz der Päpste, war später (seit 1861 und bis zum Ende der Monarchie 1946) Sitz der Könige im Vereinten Königreich Italiens und ging mit der bürgerlichen Nachkriegsherrschaft in die Hände der demokratischen Regierung Italiens über.
1200 Räume machen diesen prächtigen Palast zu einem der weltweit größten Amtssitze eines Staatsoberhaupts. Mattarellas eher bescheidene private Unterkunft auf wenigen prunkvollen Quadratmetern spricht für die Bodenhaftung des gewählten Staatsdieners und für die protokollarisch mehr als anständige Unterbringung der geladenen Staatsgäste in den weiten Gebäudeflügeln. Was heißt schon bescheiden? Ein Jagdschloss außerhalb Roms und eine Sommerresidenz im Golf von Neapel erweitern standesgemäß den Wohnradius des Präsidenten.

Quirinal und Vatikan haben ihre räumliche Nachbarschaft in Rom erhalten. Verfassungsrechtlich ist diese – retrospektiv betrachtet – missliche Allianz von Kirche und Politik in laizistischen Staaten längst entzweit.
Im Rosengewölk des Abendhimmels auf der Piazza del Quirinale sichte ich die Kuppel des Petersdoms am Horizont,

verschwindend klein hinter dem gewaltigen eisernen Kandelaber an der Brüstungsmauer um den großflächigen Platz. Hier lehnen sich in Liebeslaune verträumte Paare an, junge wie ältere, davor wirbeln zu Hip Hop und mit Flaschen in der Hand lebenslaute ragazzini durcheinander. Das Volk zwischen Kirche und Staat – ein glänzendes Abbild einer postpapalen und postroyalen Gesellschaft selbst im Dämmerlicht.
Viaggio a casa
Mit dem schwindenden Tageslicht trete ich die Heimfahrt an. In Quirinalsnähe weist mir den Weg die mit Abstand am wenigsten überladene, stilvollste weihnachtliche Straßenbeleuchtung, die ich je gesehen habe – Mond und Sterne und Symbole der großen Weltreligionen in friedvoller Reihe von Fassade zu Fassade über die Straße gespannt. Wie die sterngeleiteten Weisen aus dem Morgenland fühle ich mich zu meinem Ziel, casa mia, pilotiert.
Dort stecke ich den einzig mitgenommenen Schlüssel ins Türschloss der Hochparterre. Die äußeren metallischen Blendläden öffnen sich erwartungsgemäß. Die inneren Holzfenstertüren, die ich nie abschließe, nicht. Ich komme nicht rein, bin ohne Herberge. Uralte Vorweihnachtsgeschichte. Antonella hat also wirklich die windanfälligen Holzfenstertüren von innen versperrt. Und nun?
Dann ein Geistesblitz in der Dämmerung! Mit den letzten Ladeprozenten im Akku meines telefonino schreibe ich ihr eine Notfall-WhatsApp. Ihre lockere Antwort respektiert nicht meine vornehme Zurückhaltung als Gastbewohnerin, die eine Terrassentür in landesüblicher Leichtbauweise nicht mit Gewalt öffnen und dann eindringen möchte. „Forza“, schreibt sie noch mit Nachdruck. Schlachtruf der Forza Italia? Die Mitte-rechts-Partei, gegründet, benannt und geprägt von Silvio Berlusconi, Regierungschef mit Marathonkraft für viermaliges Intervall-Regime, ist doch derzeit längst nicht mehr in aller Munde. Meine Aussperrung ist unpolitisch, profaner. Forza – das ist wohl eher Antonellas alltagssprachliche sportliche Mutmachparole: Na los! Nur Mut! Antonella meint es nachdrücklich ernst: Wirf dich vor die Holz-Glastür, sie wird schon nachgeben! Damit ist es aber nicht getan, Antonella! Sie lenkt schließlich ein, will mit Rollerkraft und Schlüssel für die andere Eingangstür im Souterrain kommen. Aber eben nicht subito.
Es wird dauern. Es wird kalt. Ich habe Bedürfnisse – nach servizi, im doppelten Sinne des italienischen Wortes: Gästebedienung und WC. Für Letzteres bietet sich der dunkle Garten an, aber doch wohl eher für die männliche Spezies. Die erleuchteten Fenster und Balkone der palazzi (Wohnhäuser) ringsum halten mich ab. Nach willensstark kontrollierten 45 Minuten meinerseits und nur mäßiger Bewegung gegen die Abendkühle knattert schließlich Antonellas Vespa heran. Sie schließt auf, ich schlüpfe hinein. Im Abschiedsgruß noch eine Erklärung der haushälterischen Airbnb-Padrona: „Scusa, ho spento il riscaldamento.“ Die Heizung habe sie ausgemacht, weil ich ja nicht da war. Tut ihr leid. Mir erst. Das ganze Haus aus Naturstein mit Holzdach ohne Dämmung und auf drei offenen Etagen - ein einziger Eispalast in dieser Winternacht!

Mehr geht nicht an einem Tag! Der Schlaftrunk an der herrschaftlichen Balustrade meines piano nobile - so macht mich die Bilderflut aus Tivoli für ein paar trügerisch-schöne Illusionsmomente glauben - ist schnell genommen. Danach bin ich handlungsarm, wickele mich in meinen Winterdaunenmantel für die Wärme, schalte die Heizung ein und meine Sensoren ab.
































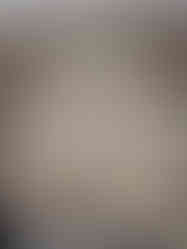





























Kommentare